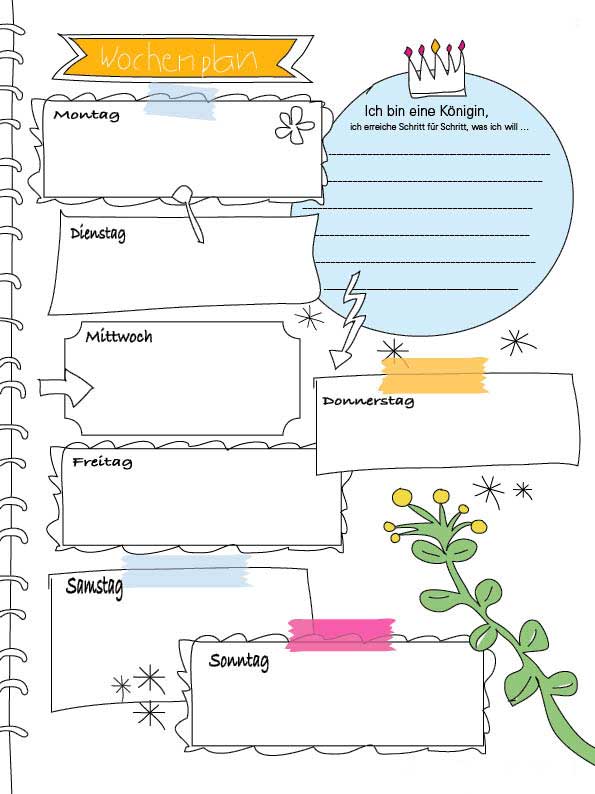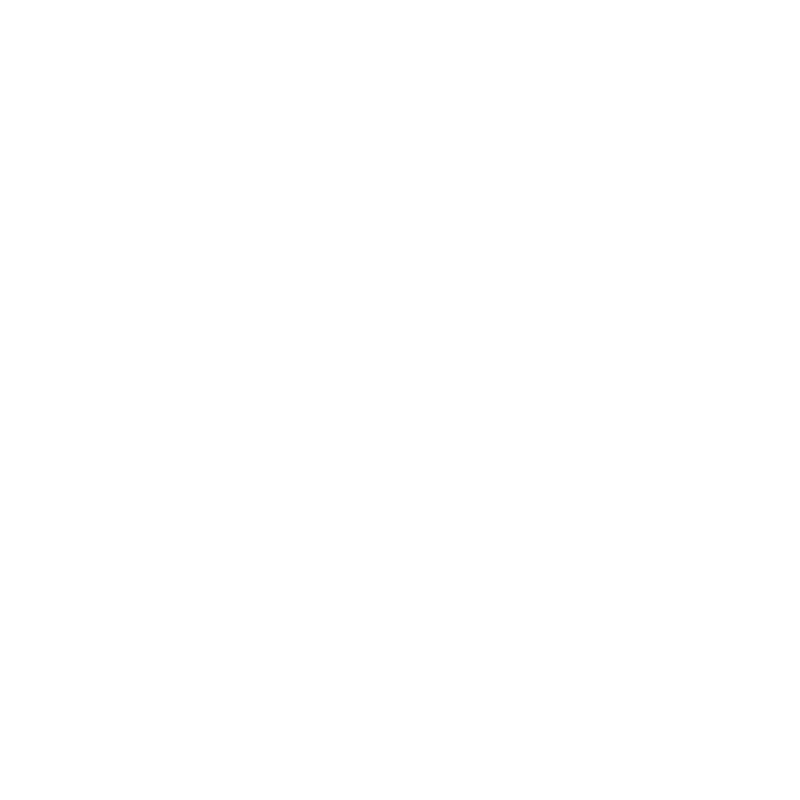Montag, 10 Uhr: Sterben

Bei einer Selbsttötung zu helfen, ist seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 auch den deutschen Sterbehilfeorganisationen erlaubt. Im vergangenen Jahr baten 346 Menschen in Deutschland um ein tödliches Medikament und bekamen es. Eine davon war die Großmutter der 18-jährigen Clara*. Ein Protokoll.
Meine Omi und ich hatten ein sehr vertrautes Verhältnis: Ich war ihr erstes Enkelkind. Ich glaube, ich hatte einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Sie war eine mutige Frau und sehr tough. Ihre beiden Kinder, meine Mutter und meinen Onkel, hat sie allein aufgezogen, nachdem ihr Mann jung gestorben war. Sie war als Französischlehrerin selbstständig, hat mit Nachhilfe angefangen und schließlich Kurse gegeben. Frankreich hat sie sehr geliebt. Überhaupt das Reisen. In ihrem Haus hingen überall Bilder aus Frankreich, aus England und anderen Ländern. Sie hat viele Freundschaften im Ausland geschlossen und sie gut gepflegt. Zu einigen ihrer Freunde haben wir immer noch Kontakt.
Schon seit Jahren sprach sie mit mir offen darüber, dass sie selbst bestimmen wollte, wann sie stirbt. Die Erwachsenen in meiner Familie machten ihr deswegen Vorwürfe: „Du kannst das dem Kind nicht erzählen!“, hieß es. Ich war ja damals erst 13 oder 14. Meine Mutter war entsetzt. Sie hatte Angst, dass Omi mich zu sehr belastet und ich damit nicht umgehen könnte. Tatsächlich war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das konnte. Aber ich wollte nicht, dass unsere offenen Gespräche aufhörten. Ich habe sie sehr geschätzt. Und damals war es für mich noch nicht Realität.
Jeden, jeden, jeden Tag die Hilflosigkeit
Wenn sie darüber sprach, tat sie das ganz nüchtern, fast rational. Sie sprach über ihre Krankheiten, die sich verschlimmerten, und wie es ihr damit ging. Sie hatte einen Tremor, so ein Zittern, ähnlich wie Parkinson, der sie sehr einschränkte, und noch einiges mehr. Im Kopf blieb sie aber klar und fit, sie war geistig völlig unbeeinträchtigt und an allem interessiert. Ein weltoffener Mensch, politisch informiert. Man konnte mit ihr über jedes Thema reden.
Aber ihr Körper machte nicht mehr mit. Sie wurde schwächer und schwächer, sie konnte das Bett nicht mehr allein verlassen. Bei Familienfeiern musste sie sich manchmal zurückziehen, weil sie erschöpft war. Fotografiert werden wollte sie nicht mehr. Die Spuren ihrer Krankheiten und des Alters, der Rollstuhl, den sie immer öfter brauchte – all das sollte nicht auf den Bildern zu sehen sein. Sie hatte immer viel Wert auf ihr Äußeres gelegt, vielleicht war sie sogar ein kleines bisschen eitel. Und nun musste sie im Bett liegen, und es wurde ihr der Po abgewischt. Das war ihr so unangenehm. Sie brauchte mehr und mehr Hilfe von ihren Pflegerinnen, zwei Frauen aus Ungarn, die abwechselnd bei ihr wohnten. Sie fand das herabwürdigend, sie schämte sich für ihre Schwäche, wenn sie vor Anstrengung verschwitzt oder nicht ganz frisch geduscht war, dabei hat das nie jemanden von uns gestört. Sie musste das jeden, jeden, jeden Tag wieder erleben, die Pflege, die Hilflosigkeit, dass ihr Geist nicht mehr zum Körper passte. Je mehr wir darüber sprachen, je mehr sie mir Auge in Auge erklärt hat, wie sie ihre Situation empfand, umso mehr konnte ich ihren Entschluss respektieren. Sie empfand den körperlichen Verfall als Verlust ihrer Würde.
Sie sagte es ganz nüchtern
Im letzten Sommer hat sie ihren Entschluss der Familie verkündet. Wir waren zu Besuch bei ihr, meine Cousine, mein jüngerer Bruder, mein Onkel. Die Stimmung war gut und gelöst, das wollte sie nutzen. Sie stand auf und sagte: „Ich will euch etwas sagen.“ Sie war einem der Sterbehilfevereine beigetreten. Sie hatte eine Broschüre, die sie uns zeigte. Sie erklärte gut, worum es ging, mit einfachen Worten, sodass es auch die jüngeren Enkelkinder verstanden. „Da geht es darum, dass Menschen frei entscheiden können, wann sie sterben.“ Sie sagte es ganz nüchtern. Aber mit einer Träne im Auge. Sie sprach davon, dass sie eine Frist abwarten müsste, die zwei Monate später ablaufen würde. Ich habe da direkt angefangen zu rechnen. Zwei Monate später – das wäre im Oktober. Schon so bald.
Es war ein Schock für uns alle. Ich wusste es ja schon, aber mein Bruder, meine Cousine hörten es zum ersten Mal. Jeder brauchte erst mal Zeit für sich. Alle haben geweint, alle sind rausgegangen, jeder in ein anderes Zimmer. Und jeder von uns ging anders damit um. Mein Onkel, ihr Sohn, versuchte mit Witzeleien Distanz zu seinen Gefühlen zu halten. Er sagte sowas wie: „Man spart ja dabei auch viel Geld!“ Das fand ich nicht gut, aber wahrscheinlich konnte er nicht anders. Meine Mutter versuchte, sie umzustimmen, hat Anreize und Argumente vorgebracht: „Denk doch an Clara, bald macht sie Abitur. Willst du das denn nicht mehr erleben?“ Und tatsächlich waren das die einzigen Momente, wo ich meine Omi zögernd erlebt habe: wenn es um ihre Enkelkinder ging. Sonst war sie ganz klar in ihrer Entscheidung, fundiert und eindeutig.
Hätten wir es verhindern können?
Es war auch der Gedanke da: Sind wir es nicht wert, dass sie für uns weiterlebt? Hätte ich sie vielleicht noch öfter besuchen sollen? Hätte sie dann stärker am Leben gehangen? Hätten wir es verhindern können? Es gab da auch sowas wie Wut oder Enttäuschung: Warum sind wir dir nicht wichtig genug, warum lässt du uns allein? Ein Suizid ist ja auch etwas fast Egoistisches, eine Zurückweisung oder kann jedenfalls so verstanden werden: Ich entscheide für mich, ich nehme keine Rücksicht auf euren Wunsch, dass ich noch länger bleiben soll.
Ich wollte das alles nicht zu sehr hinterfragen. Ich wusste ja: Es war keine leichtfertige Entscheidung. Sie hatte für sich einen durchdachten Entschluss gefasst, bei dem ihr körperlicher Zustand und ihre Autonomie schwerer wogen als alles andere. Es ging um ihr Leben, nicht um unseres. Ich hätte es respektlos gefunden, das nicht zu akzeptieren.
Sehr konkret wurde es, als sie einen Termin vereinbarte, ein Datum und eine Uhrzeit. Ab da war es wirklich krass. Es klafft dann alles so auseinander, das normale Leben kriegt einen Riss. Die Schule und all das musste ja weitergehen, und gleichzeitig dachte ich: Das geht doch nicht! Ich muss sie ganz oft besuchen und bei ihr sein. Das habe ich auch getan. Vor ihr habe ich versucht, die Fassung zu wahren, aber wenn ich dann wieder draußen war, musste ich oft weinen.
Wie soll man für immer „Tschüss“ sagen?
Vor allem hatte ich Angst davor, wie es ablaufen wird. Ich hatte Angst, dass sie Schmerzen haben könnte, dass irgendwas schieflaufen würde. Dass es kein so friedliches Ende nimmt, wie sie es sich wünschte. Und wovor ich am meisten Angst hatte: Wie soll ich mich verabschieden? Wie soll ich für immer „Tschüss“ sagen? Wie oft dreht man sich am letzten Tag wieder um, weil es noch nicht ausreicht? Weil man etwas noch nicht gesagt hat, was gesagt sein soll? Weil noch Zeit wäre, die man nutzen möchte?
Am Nachmittag vor dem Termin, also am Tag bevor sie sterben würde, kam ein Arzt von dieser Organisation zu ihr. Meine Mutter und ich waren dabei. Sie hatte mich zuvor ganz oft gefragt: „Willst du wirklich mitgehen?“ Ich wollte es unbedingt; ich wollte sehen, was da passiert; ich wollte jede verbleibende Sekunde mit meiner Omi nutzen.
An diesem Nachmittag war sie gut gelaunt, sie machte Witze und unterhielt sich ganz locker mit dem Arzt. Ich saß auf einem Stuhl dabei, habe die Szenerie beobachtet und versucht, ein bisschen Distanz aufzubauen. Meine Mutter hat viel geredet. Wenn es uns zu viel wurde, sind wir rausgegangen und haben geredet und uns ausgetauscht. Ich musste auch ein bisschen weinen, und ich wollte nicht vor meiner Omi weinen. Irgendwann konnte ich es aber nicht mehr abstellen.
Mein Onkel hat sich nicht verabschiedet. Ich weiß nicht, wann er zuletzt da war. Meine Omi sagte an dem Nachmittag: „Bisher ist er noch nicht gekommen.“ Seine Frau, ihre Schwiegertochter, hatte angerufen, tränenüberströmt, die beiden hatten eine gute Beziehung. Sie wollte meiner Omi wohl auch das Gefühl geben, dass er sich nicht deswegen nicht meldete, weil er sich nicht verabschieden wollte, sondern es nicht konnte. Meine Omi hatte dafür Verständnis. Sie fand es schade, machte es ihm aber nicht zum Vorwurf.
Ein paar Tage zuvor hatte er noch angerufen und halb witzelnd, halb verzweifelt gesagt: „Ich werde dann die Polizei rufen, damit es verhindert wird.“ Bei ihm kann man sich nie sicher sein, was er ernst meint. Und so waren wir nicht sicher, ob er kommen würde – oder ob er vielleicht wirklich mit dem Streifenwagen aufschlägt. Aber es war ja legal, was sie vorhatte.
An diesem Nachmittag wurde viel Bürokratisches besprochen, Dokumente unterschrieben und so weiter. Der Arzt war sehr, sehr kompetent und sehr lieb und erklärte uns, was auf biologischer Ebene ablaufen, wie das Medikament im Körper wirken würde und was dabei von außen zu sehen ist. Es ist ein Schlafmittel, das überdosiert wird. Man schläft ein, aber es kann zu Zuckungen kommen. Das ist ganz normal. Die Atmung setzt bald aus. Es geht sehr schnell, in fünf Minuten ist alles vorbei. Mit seinen Erklärungen hat er uns die Angst genommen.
Das wird morgen passieren, genau das
Dann wurde die Situation durchgespielt. Er hatte das Infusionssystem dabei, mit dem Regler daran, den meine Omi am nächsten Tag würde aufdrehen müssen. Er zeigte ihr alles und gab ihr den Regler in die Hand, damit sie ausprobieren konnte, wie das ging. Denn sie musste ja die so genannte Tathoheit behalten, also selbst die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie das Medikament bekam. Sie übte an diesem Nachmittag, was am nächsten Tag zu tun wäre. Es war wirklich heftig, als ich mir vorgestellt habe: Das wird morgen passieren, genau das. Wenn sie es das nächste Mal so macht, dann… Das ist eine Situation, die sich einbrennt.
Der Arzt fragte an diesem Nachmittag auch meine Mutter, ob sie nicht doch dabei sein möchte. Sie hatte das aber von Anfang an klar abgelehnt. Mich hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand aktiv gefragt, aber ganz am Ende, da fragte ich den Arzt: „Gäbe es die Möglichkeit, dass ich dabei wäre?“
Er sagte: „Ja, wenn alle einverstanden sind.“ Meine Omi hat sich total darüber gefreut. Aber sie sagte auch, dass sie mir auf keinen Fall das Gefühl geben wollte, dabei sein zu müssen. Sie würde es zu 1000 Prozent verstehen, wenn ich nicht will. Sie wäre nicht enttäuscht, es stünde mir wirklich frei. Auch wenn ich in der letzten Sekunde noch gehen möchte. Niemand hat mich zu irgendwas gedrängt.
Aber ich war mir noch nicht sicher, ich wollte es mir bis zum nächsten Tag überlegen. Mit dieser Frage bin ich nach Hause gefahren. Ich habe dann auch noch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen. Ich war mir einfach nicht sicher. In der Nacht habe ich nicht geschlafen. Ich hatte Angst, dass ich nicht damit umgehen könnte, wenn es total schlimm würde. Aber schließlich dachte ich, ich würde es eher bereuen, nicht hingegangen zu sein und mir vorstellen zu müssen, wie es war, als umgekehrt. Und ich nahm mir vor: Sobald ich ein ungutes Gefühl habe, dann lass’ ich es.
Ein Bild vom Opa. Ein schönes Nachthemd
Meine Mutter hat mich am Morgen hingefahren. Sie wollte nicht dabei, aber in der Nähe sein und ging spazieren. Ich bin rein ins Haus, der Arzt war noch nicht da. Omi und ich haben den Anlass erstmal ignoriert und über ganz normale Dinge geredet. Über die Koalitionsverhandlungen. Sie sagte: „Ich hätte jetzt schon gern noch gewusst, ob der Christian Lindner Finanzminister wird.“ Das hat es mir leichter gemacht – es gab nicht diese Hyper-Dramatik. Dafür war ich dankbar, weil ich wusste, dass sie das absichtlich so machte, für mich.
Irgendwann klingelte es. Der Arzt kam mit einer Anwältin. Die waren total lieb, supersupernette Menschen, ich hab mich sehr wohl mit denen gefühlt. Erst haben wir einfach ganz normale Vorkehrungen getroffen. Das Bett ein bisschen in die Mitte geschoben, den Stuhl ein bisschen zurück, solche Dinge. Da hatte ich eine Aufgabe, das war gut. Omi hatte ein schönes Nachthemd an und Kleidung rauslegen lassen, die sie bei der Einäscherung tragen wollte. Wir zündeten Kerzen an, sie hatte ein Bild vom Opa, ihrem vor 40 Jahren verstorbenen Mann, und ein Bild von ihren Enkelkindern aufgestellt. Es war eine sehr feierliche Atmosphäre. Der Arzt legte ihr die Infusionsnadel und spülte mit Kochsalzlösung, um zu prüfen, ob alles durchgängig war. Ich stand am Bett, die Anwältin mit ein bisschen Abstand dabei. Ich hielt ihre Hand. Wir redeten noch ein bisschen.
Sind Sie sich bewusst, dass Sie in den nächsten Minuten sterben werden?
Dann sagte der Arzt, dass er nun das Medikament in die Infusion geben würde und fragte sie noch einmal nach ihrem offiziellen, ausdrücklichen Einverständnis: „Sind Sie sich bewusst, was jetzt passieren wird? Dass Sie in den nächsten Minuten sterben werden? Sie können sich jederzeit noch dagegen entscheiden.“ Sie zögerte keine Sekunde, hat es noch mal ganz entschlossen bekräftigt: „Ja!” Dann hat sie langsam den Regler aufgedreht. Ich hielt ihre Hand. Sie sagte mir noch letzte Worte, und dann schloss sie die Augen. Ich weinte, und da war es mir auch egal, ob meine Omi das sah. Ich wollte nicht dramatisch sein, aber ich habe auch nichts dagegen getan. Ihre Atmung wurde flacher. Hörte ganz auf. Still war es, friedlich. Ruhig und würdevoll. So wie sie es wollte.
Protokoll: Susanne Zehetbauer
*Name geändert