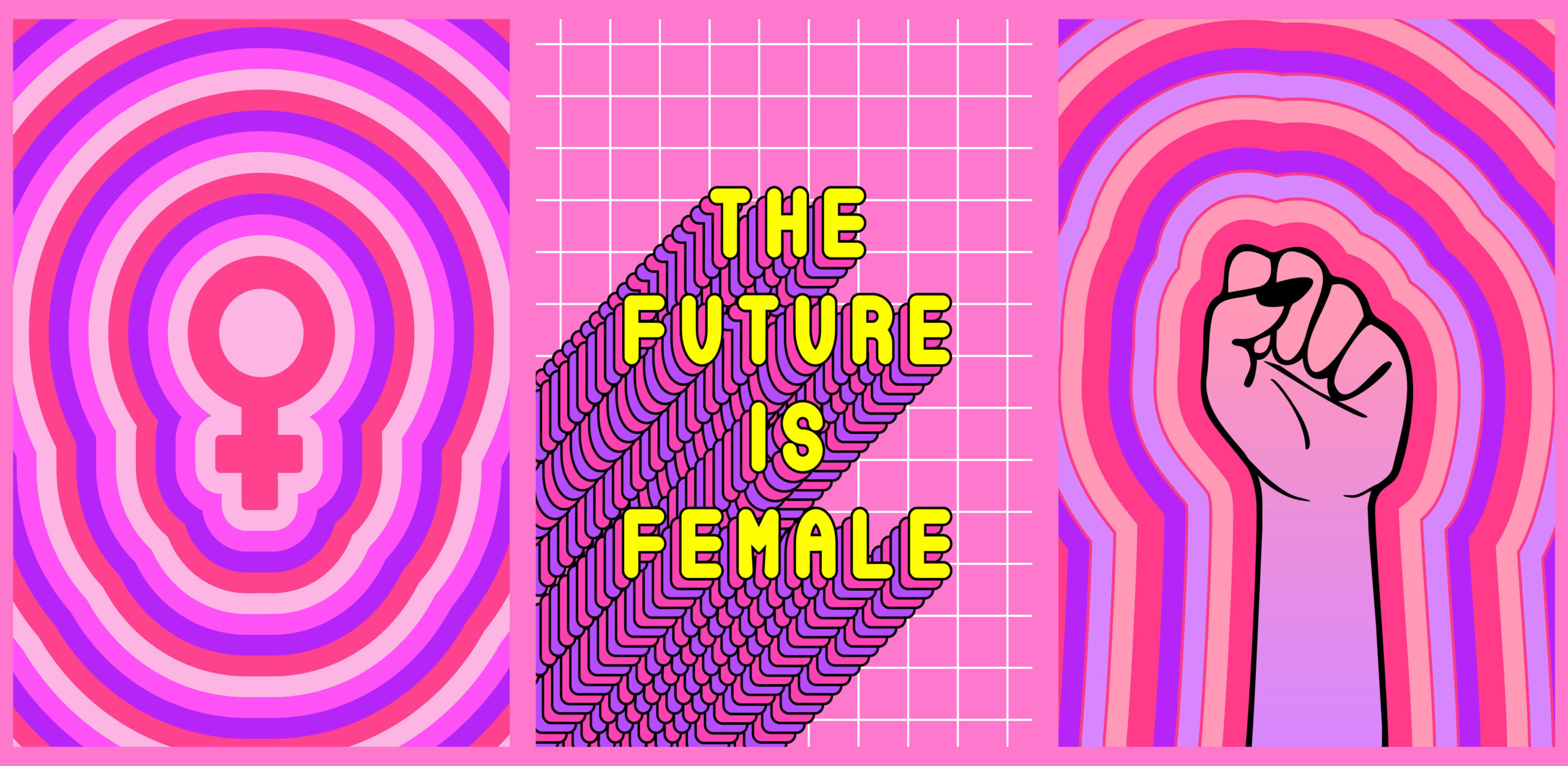Zuversicht schenken
Klimawandel, Pandemie, Krieg in Europa: Kinder und Jugendliche in Deutschland fürchten sich vor der Zukunft. Viele haben psychische Probleme. Wie können Eltern und Großeltern helfen?
Fünfmal die Woche boxen, dreimal die Woche Party, siebenmal die Woche seine Freunde treffen: Teo (16) genießt das Leben und blickt voller Erwartung in die Zukunft. „Ich freue mich eigentlich, älter zu werden und alles machen zu dürfen“, sagt er. Dennoch ist da dieses „eigentlich“. Denn die Zukunft, die noch etwas weiter weg ist, macht ihm Angst. „Ich fürchte, dass ich mit meinen Kindern viele Dinge wegen des Klimawandels nicht mehr machen kann, wie Schlittschuhlaufen oder Skifahren“, sagt er. Doch es ist nicht nur die Klimakrise, die den Schüler bewegt. „Ich hoffe, dass aus dem Russland-Ukraine-Konflikt kein globaler Krieg wird“, sagt er auch.
Mit seinen Sorgen ist Teo nicht allein. Der zwölfjährige Paul, verträumt und ernst zugleich, wünscht sich, „dass der Krieg in der Ukraine schnell vorbeigeht und es keine Toten mehr gibt“. Auch er hat aber vor allem Angst vor dem Klimawandel, „weil es in letzter Zeit schlimme Sachen wie Überschwemmungen gab“. Immer mehr Jugendliche und Kinder blicken ängstlich in die Zukunft.
Fast zwei Drittel haben Zukunftsängste wegen des Klimawandels und des Kriegs in Europa, so aktuelle Studien. Hinzu kommen die Pandemie, die Energiekrise und die Inflation – die Bedrohungen sind zahlreich. Zukunftsperspektiven werden infrage gestellt. Das düstere Weltgeschehen wirkt sich zudem auf das unmittelbare Lebensumfeld aus: Die Wohnung ist kälter als sonst, das Glas Nutella ist teurer und landet nicht mehr im Einkaufswagen, die Schwimmbäder sind teils geschlossen.
Angststörungen nehmen zu
Während der Corona-Pandemie haben Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. 29 Prozent der Jugendlichen sind psychisch auffällig, das sind zehn Prozent mehr als vor der Pandemie, so eine Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Die Symptome sind oft psychosomatisch: Gereiztheit, Einschlafprobleme, Niedergeschlagenheit. Arztbesuche von Jugendlichen wegen Angststörungen oder Depression haben sich von 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. Auch Essstörungen und Suchterkrankungen haben deutlich zugenommen, sagt Inga Wermuth, Oberärztin an der Münchner LMU-Uniklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Jeder zwölfte Jugendliche befindet sich derzeit in Therapie. Die Kita- und Schulschließungen während des Corona-Lockdowns und damit der Wegfall Halt gebender Strukturen, soziale Isolation durch den mangelnden Kontakt zu Freunden, wenig Sportmöglichkeiten und Bewegungsmangel haben zu Zukunftsängsten und Vereinsamung geführt.
Junge Menschen, gerade vor Übergängen wie dem Ende der Schulzeit, sind stark verunsichert und orientierungslos. Bei Jugendlichen nimmt die Beziehungsangst zu. Sie tun sich schwer, Beziehungen zu knüpfen und haben Probleme, stabile Freundschaften aufzubauen. Dazu kommt, dass sie in dem Alter häufig das Gefühl haben, den Anforderungen von Schule und sozialem Leben nicht gewachsen zu sein. „Viele Schüler*innen haben am Ende der Corona-Maßnahmen den Weg zurück in die soziale Gemeinschaft und wieder hinaus in die Welt nicht mehr geschafft, sind in der Isolation verharrt und haben soziale Ängste entwickelt“, beobachtet Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christine Niggl.
Wie Ängste entstehen
Wann aber muss ein Kind wegen Ängsten zum Arzt? Zu allererst: Angst ist kein Makel, sondern ein wichtiger Bestandteil des Lebens, ein Frühwarnsystem, ein Schutzmechanismus vor gefährlichen Situationen.
Entscheidend ist der richtige Umgang mit Angst. Es ist wichtig, Angst zuzulassen und das Gefühl zu vermitteln, dass Angst normal ist. Es hilft zu wissen, dass es Ängste gibt, die in einem bestimmten Alter zur gesunden Entwicklung des Heranwachsenden gehören, sogenannte entwicklungsbedingte Ängste. Sie entstehen meist in Umbruchphasen während körperlicher und geistiger Veränderungen.
Vom Baby zum Teenager: Wie sich Ängste mit dem Alter verändern

Säuglingsalter:
Kontakt-Verlust-Angst
Angst, die emotionale und körperliche Nähe von Mutter und Vater zu verlieren
– Bindung schaffen, die so wichtig ist wie Trinken und Schlafen.
Ab acht Monaten:
Fremdeln, Trennungsangst
Das Kind kann zwischen bekannten und nicht bekannten Personen unterscheiden, Angst vor nicht vertrauten Personen
– langsam an neue Gesichter gewöhnen.
Ab zwei Jahren (Kindergarten):
Verlassenheits-, Vernichtungsängste (Entführung, Ermordung, Verletzung)
Angst vor Abschied von der Bezugsperson – Zeit für Eingewöhnung nehmen, klare Strukturen und Zeiten vorgeben, Trost durch vertraute Dinge wie Teddybär,
Puppe oder Schmusetuch als Beschützer.
Magische Phase: Furcht vor Gespenstern, Monstern, Dunkelheit, Gewittern und Katastrophen
– Angst ernst nehmen, keine Erwachsenen-Nachrichtensendungen (Kinder sehen die Bilder, ohne die Erklärungen zu verstehen), Rituale finden, um die Angst zu verjagen, Märchen, Kasperltheater, Puppenspiele, Rollenspiele, in denen das Gute siegt.
Schulalter (sechs bis zwölf Jahre):
Soziale Ängste, Beschämungsangst
Neue soziale Gruppen stellen neue Anforderungen; Angst, keine Freunde zu finden, Leistungen nicht zu erbringen, von anderen beurteilt zu werden
– Leistungsdruck nehmen, mit Lehrern sprechen,
Jugendliche (13 bis 18 Jahre):
Verletzungsangst, Angst vor Krankheit, Sexualität, sozialen Situationen
– Über Gedanken und Gefühle sprechen
Grundsätzlich hilft in jedem Alter:
Mit Nähe und Sicherheit das Selbstbewusstsein des Kindes stärken und Lösungen und Rituale gegen die Ängste finden.
Buchtipps:
Hajo Bücken: Auch kleine Leute haben‘s schwer. Burckhardthaus-Laetare, 2014, 14,95 Euro.
Ulrike Légé, Fabian Grolimund: Huch, die Angst ist da!. Hogrefe, 2021, 19,95 Euro.
Kinder reagieren auf Unsicherheiten der Eltern
Die vierjährige Kleo etwa mag nicht allein im Bett schlafen. Sie fängt zu weinen an und möchte ins Bett ihrer Mama. Sie fürchtet, Piraten könnten ihre alleinerziehende Mutter holen. „Kinder reagieren auf die Unsicherheit und die Ängste der Eltern“, erklärt Therapeutin Niggl. Im Vorschulalter sind Ängste vor allem auf das direkte Umfeld bezogen.
Die Angst vor der Zukunft hingegen wird häufig von gesellschaftspolitischen Entwicklungen ausgelöst. Sie hat eine globale Dimension und bezieht sich auf etwas Unbestimmtes, auf eine ungreifbare Bedrohung von endzeitlichem Charakter. Dazu gehören persönliche Zukunftsängste, etwa vor Jobverlust, Krankheit, sozialem Abstieg. Die 19-jährige Lilo, die immer wieder mit sich hadert, fürchtet, nichts zu finden, was sie erfüllt. Lucia (18), selbstbewusst und lebenslustig, hat manchmal Angst, eine falsche Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen. Doch auch Zukunftsängste, die sich auf die Gesellschaft beziehen, bewegen die junge Generation. Die 19-jährige Lotta sorgt sich um die Menschheit: „Wenn es so weitergeht und viele Menschen immer nur an sich selbst denken, wird das Leben auf der Erde, glaube ich, nicht mehr so schön sein.“ Solche Sorgen sind nicht ungewöhnlich für heutige Teenager. „Die Klimaangst ist durchaus berechtigt und hat ja auch eine sinnvolle Funktion“, erklärt Wermuth. „Durch Angst zeigt uns die Psyche, dass wir eine Bedrohung wahrnehmen. Das können eben auch zukünftige Gefahren sein wie die Folgen der Klimakrise“, so die Oberärztin. „Im besten Fall führt diese Angst dazu, dass wir nach Lösungen suchen, uns emotional mit unserer Situation auseinandersetzen und gesunde Bewältigungsmechanismen anwenden“, sagt sie.
Medienbilder belasten
Inzwischen übertreffen die Ängste vor gesellschaftsgemachten Krisen wie Umweltkatastrophen und Krieg die persönlichen Zukunftsängste der Kinder und Jugendlichen bei Weitem. Das liegt daran, dass sie mehr Zugang zu Informationen und Bildern haben. Während der Pandemie ist der Medienkonsum gestiegen, zahlreiche Infokanäle buhlen um Aufmerksamkeit. Aber Kinder können die Eindrücke noch nicht verarbeiten. Wenn sie von frühem Alter an mit bedrohlichen Bildern der Außenwelt konfrontiert werden, können sie die Bedrohung noch nicht durch eigenes Handeln abmildern. „Es ist ein gutes Zeichen, wenn Kinder und Jugendliche sich für ihr Lebensumfeld interessieren, Zusammenhänge verstehen wollen und eigene Bezüge erkennen“, sagt Wermuth. Bei komplexen, globalen Krisen wie der Klimakrise, der Corona-Pandemie oder der Energiekrise könne dies aber zur übermäßigen Belastung führen. Denn Kinder können solche Veränderungen ihrer Lebensumwelt nicht bewältigen, anhaltende Sorgen und Ängste entstehen.
Tatsächlich vereint Zukunftsangst mehrere Grundängste wie Todesangst, Trennungsangst oder Angst vor Hoffnungsverlust. „Die Klimakrise ist eine anhaltende Belastung und stellt zudem unsere Lebensgrundlage infrage“, so die Ärztin. Sie ist menschengemacht, gleichzeitig kann kein Einzelner dafür verantwortlich gemacht werden. Das ist belastend. „Gerade bei Erkrankungen wie Depressionen und Ängsten kommt es vor, dass Kinder sich nicht oder erst sehr spät mitteilen“, sagt Wermuth. „Dann fällt erst durch einen sichtbaren Rückzug oder durch reduzierte Alltagsaktivität auf, dass sich das Kind verändert hat. Auch Gereiztheit oder aggressives Verhalten können auf eine emotionale Belastung hindeuten“, so die Oberärztin.
Mit Ängsten umgehen
Sein Lego hat er seit Wochen nicht angerührt. Mit Freunden will sich Ben auch nicht treffen. Der Fünfjährige liegt am liebsten auf seinem Bett und hat noch nicht mal Lust, seine geliebten Comics durchzublättern. „Wenn Kinder nur sachlich über Bedrohungen sprechen, ihre Gefühle dabei abspalten oder nur noch funktionieren und teilnahmslos sind, kann das an solchen Ängsten liegen“, sagt Sozialpädagoge Karl-Heinz Bittl. Durch den Verlust an Vertrauen in eine gesicherte Zukunft ziehen sie sich zurück. Auch das Gegenteil kann ein Indiz sein: wenn Kinder übertrieben aktiv werden und von einem Ereignis zum nächsten springen. Für Eltern können das Alarmsignale sein, die zeigen, dass ihr Kind Unterstützung braucht. Tatsächlich können Eltern einiges tun, um zu helfen.
Tipps für Eltern: Das stärkt Kinder und Jugendliche
1. Die eigenen Gefühle in die Beziehung einbringen.
2. Erfahrungen teilen, die zeigen, dass schwierige Bedingungen bewältigbar sind.
3. Feste Regeln und klare Rahmenbedingungen schaffen.
4. Heldinnen- und Fantasiegeschichten gemeinsam ausdenken.
5. Ein Stärkentagebuch, in das Kinder täglich aufschreiben, was sie heute gestärkt hat, oder Brief an eine Figur, die ein*e Held*in ist. Was wünsche ich mir von ihr/ihm? Oder überlegen, was ich verändern würde, wenn ich zaubern könnte.
6. Handlungsfähigkeit vermitteln, zum Beispiel Baum pflanzen, auf Plastik verzichten.
7. Körperübungen, zum Beispiel tanzen, um den Zugang zu Körper und Gefühlen zu bekommen.
8. Raum für kreativen Ausdruck schaffen mit Malen, Töpfen, Basteln.
Über Ängste sprechen
„Generell sollten Eltern ihre Kinder ermutigen, über ihre Gedanken und Gefühle zu sprechen, nicht nur in Bezug auf Krisen. Dabei sollten sie gut zuhören und auch vor schwierigen Themen nicht zurückweichen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche in Belastungssituationen besser in der Lage sind, darüber zu sprechen“, rät Wermuth.
„Über Ängste zu reden, hilft, dadurch fühlt sich das Kind verstanden und weniger alleine“, sagt Sozialpädagoge und Konfliktberater Karl-Heinz Bittl. Er rät, die Angst ernstzunehmen, das Selbstbewusstsein zu stärken und das Kind zu fragen, was gegen die Angst helfen könnte. Eltern können gemeinsam mit dem Kind Geschichten ausdenken, in denen das Gute gewinnt. Sie können Magier spielen und das Kind nach seinen Zauberwünschen fragen. Oder dem Kind zeigen, wie es selbst aktiv werden kann, malen, wie man die Angst besiegen könnte. Denn Angst lässt sich besser aushalten, wenn das Kind das Gefühl hat, etwas dagegen unternehmen zu können. Dadurch lernt es, dass es seinem Alltag gewachsen ist. „Für Kinder ist es wichtig, von uns Erwachsenen zu erfahren, dass sich schwierige Bedingungen bewältigen lassen“, sagt Bittl. Eltern sind Vorbilder. „Ein Elternpaar, das selbst zuversichtlich ist, kann diese Zuversicht auch seinen Kindern vermitteln“, sagt Therapeutin Niggl.
Bedrohliches Weltgeschehen bewältigen
Stichwort Energiekrise: Am besten hilft, mit den Kindern darüber zu reden, wie wertvoll Energie ist. Statt rigide Sparmaßnahmen anzuordnen, ist es besser, wenn Kinder eigene Ideen entwickeln, um Strom zu sparen. Haben Kinder die Möglichkeit, selbst etwas zu verändern, werden sie mutiger und optimistischer. „Gerade bezüglich der Klimakrise kann zum Beispiel ein Engagement gegen Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit helfen“, empfiehlt der Sozialpädagoge Bittl. „Manchmal kann man gemeinsam nachdenken und diskutieren, ein andermal durch den Blick auf das Bestehende, das Sicherheit-Gebende und das Gute zu einer optimistischen Haltung kommen und ein weiteres Mal etwas unternehmen, sei es für sich selbst, sei es für eine Verbesserung oder Lösung der Probleme unserer Umwelt“, ergänzt Wermuth.
Oder der Ukrainekrieg: Bei Bedrohungen hilft es, positive Gedanken zu stärken, in diesem Fall, über Frieden zu sprechen. Das macht Hoffnung im Konfliktgeschehen. Dadurch wird die Perspektive gewechselt. „Wenn wir über Krieg sprechen, dominiert er auch“, sagt Bittl. Es gehe darum, die Kraft des Guten zu spüren. Resilienz wird erzeugt, wenn die lebensbejahende Seite gestärkt wird, ohne dabei die negative aus dem Blick zu verlieren. Und Hoffnung ist eine lebensnotwendige emotionale Kraft, die dem Kind ermöglicht, planend und handelnd in eine offene Zukunft zu gehen.
Nach seinen Zukunftswünschen gefragt, antwortet der 16-jährige Teo: „Ich wünsche mir, dass auf der Welt Frieden herrscht, ich gesunde Kinder haben werde und die Klimakrise unter Kontrolle gebracht wird.“
Autorin: Katrin Otto
Hilfreiche Links
Lieder und Film zum Thema Frieden zum gemeinsam anschauen oder anhören:
https://www.swr3.de/playlisten/songs-fuer-den-frieden-ukraine-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=XO_teIfoBrI
Fachliche Hilfe bei psychischen Problemen:
Dein Infoportal für Depressionen bei Kindern & Jugendlichen | Ich bin alles (ich-bin-alles.de)